James Shapiro erzählt vom Zweifel an Shakespeare: Contested Will
Shakespeare lebt, ist aber kein anderer
James Shapiro erzählt in einem sehr lesenswerten Buch von der Geschichte des Zweifels an der Autorschaft Shakespeares, rettet die Bedeutung der Fiktion vor dem autobiographischen Missverständnis von Literatur und entwirft bemerkenswerte Portraits von Verschwörungstheoretikern.
Für die Freunde randständiger Gelehrsamkeit und gepflegter Verschwörungstheorien – zumindest zu Ersteren zähle ich mich uneingeschränkt – ist die Shakespeare-Frage ein steter Quell der Freude. Der Zweifel daran, dass die Werke, die wir als Werke Shakespeares kennen, wirklich von jenem William Shakespeare geschrieben wurden, der 1564 in der mittelenglischen Kleinstadt Stratford-upon-Avon geboren wurde, dieser Zweifel ist jetzt schon mehr als einhundertfünfzig Jahre in der Welt.
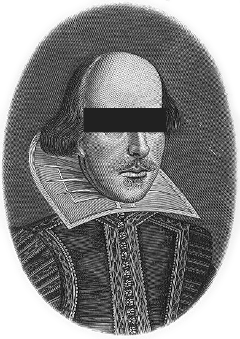 Der Sohn eines Handschuhmachers aus einem Provinzkaff, über dessen Schulbildung nichts verzeichnet ist, ein Schauspieler und Kaufmann, kleinlich in Gelddingen, der England nie verlassen und ausweislich seines Testaments kein einziges Buch besessen habe (manche halten ihn gar für einen Analphabeten): ausgerechnet dieser „Stallbursche“ soll die bedeutendsten dramatischen Werke der Neuzeit verfasst haben? Woher sollte er die profunden Kenntnissen Italiens, der Juristerei, der höfischen Kultur und Politik gewonnen haben, die es brauchte, um Romeo und Julia, den Kaufmann von Venedig, den Hamlet, den King Lear oder den Macbeth zu schreiben?
Der Sohn eines Handschuhmachers aus einem Provinzkaff, über dessen Schulbildung nichts verzeichnet ist, ein Schauspieler und Kaufmann, kleinlich in Gelddingen, der England nie verlassen und ausweislich seines Testaments kein einziges Buch besessen habe (manche halten ihn gar für einen Analphabeten): ausgerechnet dieser „Stallbursche“ soll die bedeutendsten dramatischen Werke der Neuzeit verfasst haben? Woher sollte er die profunden Kenntnissen Italiens, der Juristerei, der höfischen Kultur und Politik gewonnen haben, die es brauchte, um Romeo und Julia, den Kaufmann von Venedig, den Hamlet, den King Lear oder den Macbeth zu schreiben?
So oder so ähnlich hat man den Zweifel formuliert und andere Autoren benannt, die man als Urheber für wahrscheinlicher hielt und von denen man nachweisen zu können glaubte, dass sie einen Teil ihres Werkes unter dem Pseudonym William Shakespeare veröffentlicht haben: Das Universalgenie Francis Bacon etwa, oder der Dramatiker Christopher Marlowe oder Edward de Vere, der 17. Earl of Oxford und Großkämmerer am Hofe Königin Elisabeths I. – um nur drei von etwa fünfzig Kandidaten für die Urheberschaft zu nennen. Elisabeth selbst stand auch schon einmal in Verdacht.
Der Kreis der Shakespeareskeptiker ist dabei stets ausgesprochen illuster gewesen: Mark Twain etwa gehörte dazu, Sigmund Freud, Charlie Chaplin. Henry James hielt diesen „göttlichen William für den größten und erfolgreichsten Betrug, der je an einer langmütigen Welt begangen wurde“.
Der Mann, der Shakespeare erfand
Die meisten heutigen Skeptiker sind Anhänger des genannten Earl of Oxford. Für den deutschen Markt hat letztes Jahr der Kölner Germanist, Übersetzer und Hörspielautor Kurt Kreiler die Argumente der „Oxfordianer“ noch einmal aktualisiert und ergänzt. Man muss aber schon einige Geduld mitbringen, um sich durch die über fünfhundert Seiten an spekulativer Biographie zu kämpfen, die er unter dem Titel Der Mann, der Shakespeare erfand im Insel Verlag vorgelegt hat. Seine Kampfschrift gegen die „fixe Idee“ der Literaturwissenschaft, die dem „gerissenen Etikettenschwindel“ um William Shakespeare folge und diesem durch ihr „Geschwätz“ ein Denkmal setze, hat zumindest mich in keiner Hinsicht überzeugen können (im übrigen auch geneigtere Leser nicht).
Einen Dreh weiter noch, so höre ich, schraubt zuletzt der umtriebige Nachfahr de Veres, Charles Beauclerk, die Verschwörungstheorie (Shakespeare’s Lost Kingdom, gerade erschienen): Edward sei nicht nur Shakespeares Ghostwriter gewesen, sondern auch der illegitime Sohn Elisabeths I. – und ihr Liebhaber, mit dem sie einen weiteren Sohn, zugleich Enkel, gehabt habe: jenen Earl of Southampton, den Shakespeare, also Edward, in seinen Sonetten besinge. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich da jetzt nicht doch den Überblick verliere.
Autobiographische Kurzschlüsse
Wie es zu solchen Spekulationen kommt, erklärt James Shapiro. Der an der Columbia University lehrende Literaturwissenschaftler hat jüngst seine Geschichte der Verschwörungstheorien um Shakespeare vorgelegt: Contested Will. Who Wrote Shakespeare? Shapiro lässt keinen Zweifel daran, dass und warum er die Argumente der Oxfordianer, Baconianer und anderer Shakespeareverächter für nicht nachvollziehbar hält. Aber nicht darum geht es ihm, sondern um ihre Motive und um die Genese ihres Literaturverständnisses.
Voraussetzung der Shakespearetheorien ist natürlich die enorme Lücke zwischen dem biographischen Interesse am „göttlichen“ Stückeschreiber und den ausgesprochen spärlichen Quellen zu seinem Leben. Viel mehr als ein paar kaufmännische Dokumente und ein Testament ist nicht erhalten. Die Lücke bietet reichlich Raum für spekulative Füllungen – und für Fälschungen, auch davon erzählt Shapiro. Aber hinzu kommt etwas anderes, so eine Art zweifacher autobiographischer Kurzschluss.
Zum einen werden Shakespeares Werke als Steinbruch verrätselter autobiographischer Selbstauskünfte genommen, die es zu entschlüsseln und zu einer wahren Biographie zusammen zu fügen gelte. Zum anderen aber werde diese Methode einer entfiktionalisierenden Lektüre verrechnet auf die Annahme, alle gute Literatur könne nur auf Basis des eigenen Erlebens des Autors entstehen, Literatur sei im Kern stets autobiographisch. Letzteres ist für die Literatur der Moderne schon wenig plausibel, für die Vormoderne ist sie haltlos. Und Shapiro scheint sie in Bezug auf Shakespeare irgendwie persönlich zu nehmen:
Was ich am meisten entmutigend finde an der Behauptung, Shakespeare aus Stratford habe es an der Lebenserfahrung gemangelt, um die Stücke zu schreiben, ist, dass sie gerade die Sache herunterspielt, die ihn so außerordentlich macht: seine Vorstellungskraft.
Die bemerkenswerte Delia Bacon
Die Geschichte des Zweifels hat im Übrigen vieles, was man für einen anständigen Verschwörungsthriller a la Dan Brown braucht: seltsame Privatgelehrte, die mit verbissenem Ernst, Werke der elisabethanischen Zeit nach verschlüsselten Geheimmitteilungen durchsuchen, vermeintlichen Hinweisen auf geheime Verstecke nachgehen, die verschollene Manuskripte bergen sollen, und dabei ihren Ruf, ihr Vermögen, ihre Gesundheit ruinieren.
Shapiro hat genug erzählerisches Geschick, um das in eine ebenso spannende wie kluge Rezeptionsgeschichte Shakespeares zu packen und er entwirft dabei durchaus respektvolle – manchmal ein bisschen viel rumpsychologisierende – Portraits der Verschwörungsheoretiker.
Besonders die Geschichte der bemerkenswerten Delia Bacon (1811-1859), einer amerikanischen Literatin, die ganz am Anfang der alternativen Shakespeare-Theorien steht (ihr Namensvetter Francis Bacon war ihr Champion), ist ausgesprochen lesenswert.
James Shapiro: Contested Will. Who Wrote Shakespeare? New York: Simon & Schuster, 2010.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere, Earl of Oxford. Frankfurt a. M. u. Leipzig: Insel Verlag, 2009.